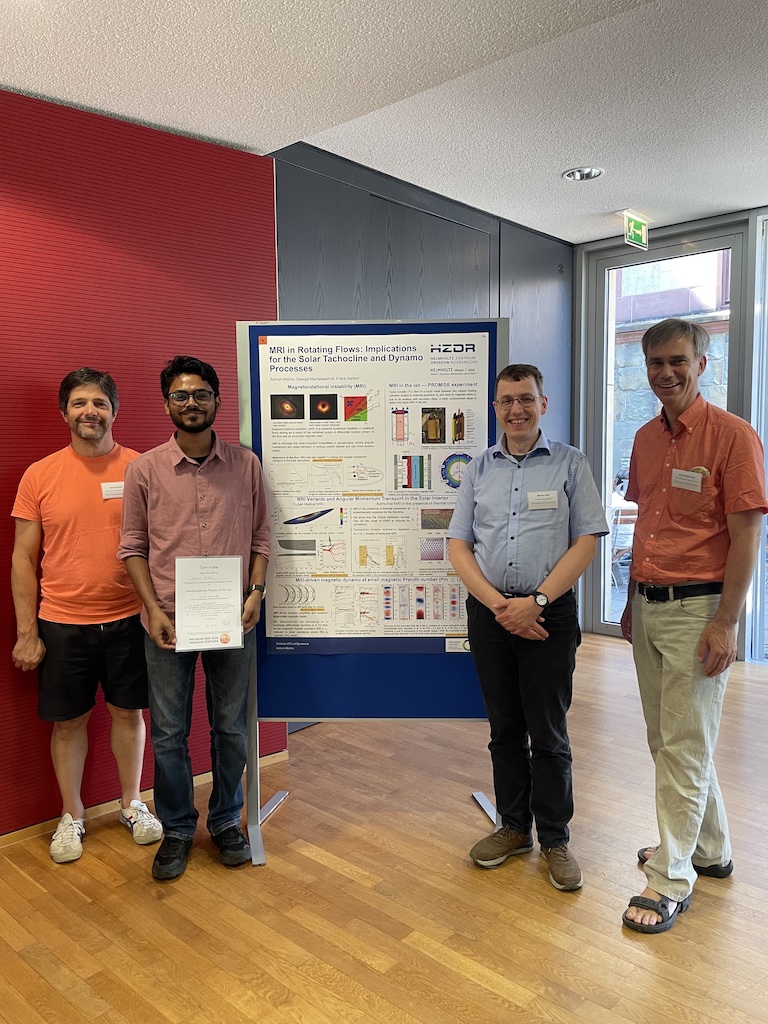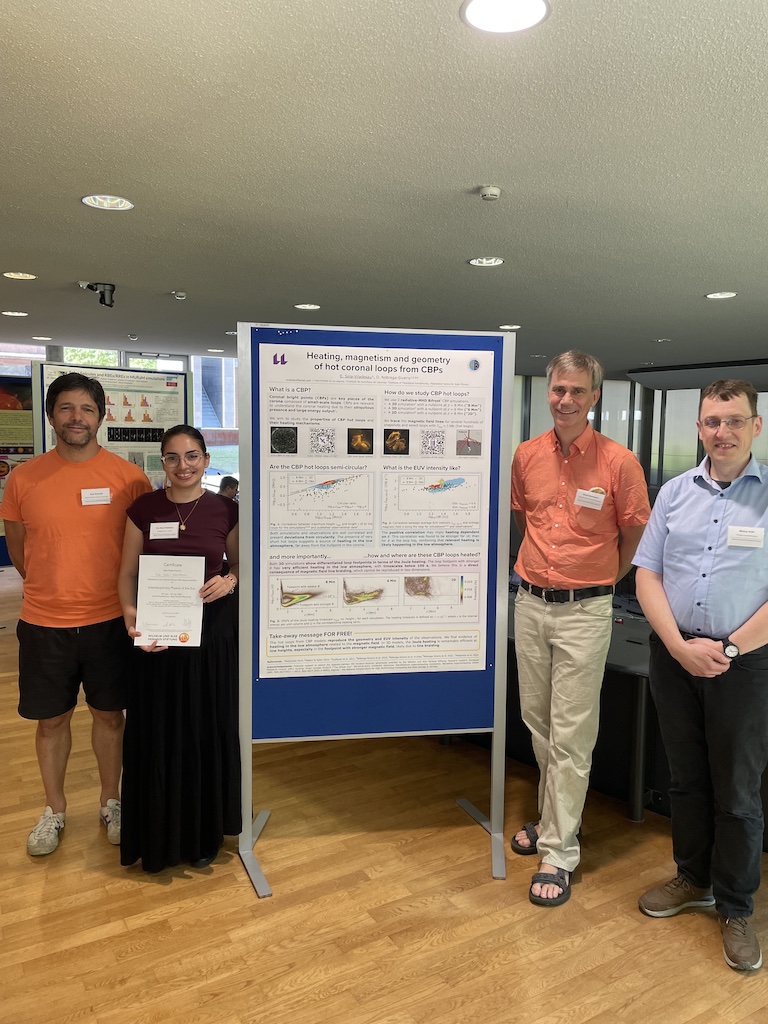Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bei einem Spanisch-Deutschen Forschungsseminar einen interdisziplinären Blick auf unsere Sonne geworfen. Wissenschaftlicher Mitorganisator der Tagung war Markus Roth, Direktor der Thüringer Landessternwarte.
"Interdisciplinary Physics of the Sun" – unter diesem Forschungs-Blickwinkel luden Markus Roth, Daniel Bemmerer vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, und Aldo Serenelli vom Institute of Space Sciences in Cerdanyola del Valles, Spanien, vom 29. Juni bis 4. Juli 2025 zu einer Tagung in das Physikzentrum Bad Honnef ein. Finanziert wurde die Veranstaltung von der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung.
 Zwischen spanischen und deutschen Astronomen gibt es seit vielen Jahrzehnten eine enge wissenschaftliche Verbindung. Am Observatorio del Teide auf der kanarischen Insel Teneriffa stehen beispielsweise die Sonnenteleskope Vakuum-Turm-Teleskop und GREGOR, mit denen Sonnenphysiker aus beiden Ländern Vorgänge auf unserem Stern untersuchen.
Zwischen spanischen und deutschen Astronomen gibt es seit vielen Jahrzehnten eine enge wissenschaftliche Verbindung. Am Observatorio del Teide auf der kanarischen Insel Teneriffa stehen beispielsweise die Sonnenteleskope Vakuum-Turm-Teleskop und GREGOR, mit denen Sonnenphysiker aus beiden Ländern Vorgänge auf unserem Stern untersuchen.
Magnetische Ausbrüche in der Corona modellieren
Bei der Tagung berichtete das spanisch-deutsche Forschungsteam, das die Sonnenteleskope auf den Kanarischen Inseln nutzt, über neue Beobachtungen und auch Modellierungen magnetischer Ausbrüche in der Corona, die nunmehr mit einer Auflösung im 100-km-Bereich untersucht werden können und Aufschlüsse über das Weltraumwetter bieten.
Obwohl das angestrebte European Solar Telescope (EST) und das neue Teleskop-Netzwerk "Solar Physics Research Integrated Network Group" (SPRING) noch nicht stehen, helfen neue instrumentelle und Analysearbeiten gerade aus deutschen Instituten bereits jetzt, die Physik hinter der solaren Aktivität zu verstehen. Sehr dicht an aktuellen Problemen waren Arbeiten, die die totale Abstrahlung unserer Sonne an historischen Aufzeichnungen und Isotopendaten über Jahrtausende zurückverfolgten.
Verbesserte Daten zu Neutrinoflüssen erwartet
Die im Rahmen des "Solar Fusion III Reviews" neu evaluierten Wirkungsquerschnitte für die Fusionsreaktionen der Proton-Proton-Ketten und des CNO-Zyklus (benannt nach den Elementen Kohlenstoff (Carbon), Stickstoff (Nitrogen) und Sauerstoff (Oxygen), die als "Katalysator" wirken) wurden mit dem aktuellsten Sonnenmodell verglichen. Obwohl es im Moment keinen dedizierten Sonnenneutrino-Detektor gibt, besteht begründete Hoffnung, dass die Neutrino-Experimente SNO+ (Nachfolger des Sudbury Neutrino Observatory), JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) und wohl auch die Flüssig-Xenon-Detektoren in den nächsten Jahren quasi als Nebenprodukt verbesserte Daten zu den solaren Neutrinoflüssen vorlegen werden. In den USA gibt es gleich an zwei Laboren Anstrengungen, die Opazitäten für die Sonne relevanter Elemente neu zu vermessen.
Insgesamt diskutierten 56 Teilnehmer aus Deutschland und dem Partnerland Spanien, aber auch aus Algerien, Belgien, China, Großbritannien, Italien, Japan, den Niederlanden, Südkorea und den USA über jüngste Fortschritte und neue Forschungsfragen rund um die Sonne. Die Themen reichten von der Teilchenphysik über Magnetohydrodynamik bis zu den Auswirkungen auf das Erdklima. Im Rahmen der Tagung wurden auch Forschungsergebnisse und Poster von jungen Forscherinnen und Forschern ausgezeichnet.
Eine Erkenntnis des Workshops: Der fachübergreifende Austausch war besonders fruchtbar, gerade weil hier zwei traditionell getrennte Forschungsdisziplinen, nämlich die Kernphysik und die Astrophysik, zusammenkamen. Dies zeigt sich etwa bei Fragen zu den Elementhäufigkeiten, zu denen neue Auswertung der Fraunhoferschen Absorptionslinien gezeigt wurden. Diese sind eng verknüpft mit der Modellierung des Materialtransports und dessen Entwicklung in der Sonne und über die Kernreaktionen auch mit Neutrinos aus dem Sonneninneren. Die Hoffnung ist groß, dass die während der Tagung geknüpften Kontakte künftig neue Forschungsrichtungen anstoßen werden.
|
Andres Vicente Arevalo (zweiter von links) vom Institut für Sonnenphysik (KIS) wurde für sein Poster "First 3D inversion of solar prominences" mit einem Preis geehrt. Mit auf den Bildern sind die wissenschaftlichen Organisatoren der Tagung: Markus Roth (links), Aldo Serenelli und Daniel Bemmerer. |
Daye Lim (zweite von rechts) von der KU Leuven gewann einen Poster-Preis für "Quasi-Periodic Pulsations in EUV Brightenings". Alle Bilder stammen von der Konferenz-Webseite. |
|
Das Poster von Ashish Mishra vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf wurde ebenfalls ausgezeichnet. Sein Thema: "MRI in Rotating Flows". |
Eva Sola-Viladesau von der Universidad de La Laguna, Spanien, erhielt den Poster-Preis für "Heating, magnetism and geometry of hot coronal loops from CBPs". |